Ex-Finanzchef hat ein Buch über Curevac geschrieben
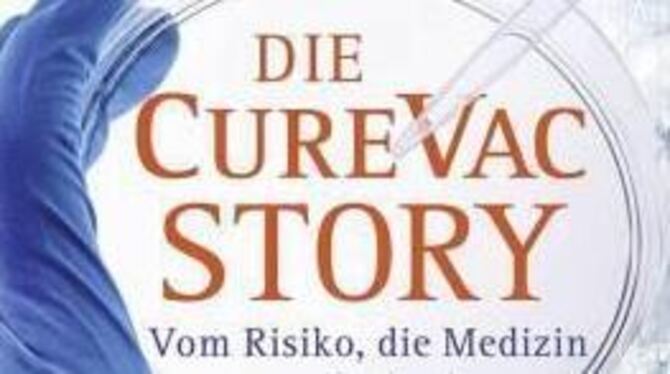
Wolfgang Klein, Die CureVac Story Vom Risiko, die Medizin zu revolutionieren. 247 Seiten 24,95 Euro. Campus Verlag
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
